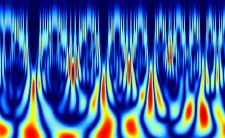Eine Kurzgeschichte von Herbert W. Franke
Die Hexe soll brennen!
Das Vermögen zu denken gehört zu den wichtigsten Mitteln des Überlebens. Verständlicherweise ist es vor allem auf die Bedürfnisse der Gegenwart gerichtet, darauf, für sich selbst Vorteile herauszuholen und Nachteile abzuwenden. Ebenso wichtig ist es freilich, den eigenen Lebensraum zu erhalten; oft genug ergibt sich zwischen den aktuellen Bedürfnissen und den langfristigen Notwendigkeiten ein Dilemma. Wenn man es als solches erkennt, ist schon der erste Schritt getan, aber der erste Schritt ist stets der schwerste.
Von Herbert W. Franke
Der Beobachter hatte das Specimen einer hübschen jungen Frau gewählt. Nachdem die Fremden die Verhaltensweisen der Menschen einige Monate hindurch studiert hatten, glaubten sie annehmen zu dürfen, dass er in dieser Rolle die besten Kommunikationsmöglichkeiten haben würde.
Antoine lag mit ihr mitten im Weizenfeld, in einer Mulde, die sich während ihrer Liebesstunden mehr und mehr vertieft hatte – und das war gut so, denn man konnte sie von außen nicht sehen.
»Ich liebe dich so sehr«, sagte Antoine. Er hatte sich ein wenig aufgerichtet, um Xandra besser sehen zu können. Ihr Gesicht war ebenmäßig, die Lippen voll und rot, die Augen dunkel, fast schwarz. Ihre Haare hatten sich rundherum ausgebreitet und knisterten, als er darüberstrich.
»Ich möchte immer mit dir zusammen sein«, flüsterte er, »ich könnte ohne dich nicht mehr leben!«
»In einigen Wochen wirst du verheiratet sein«, sagte das Mädchen.
»Das hat keine Bedeutung – für uns. Das ist etwas anderes.« Plötzlich erschrak er... Schon der Gedanke... »Wir werden uns doch wiedersehen«, fragte er fast flehend.
Ein paar Sekunden ließ sie ihn zappeln, dann streckte sie die Arme aus und zog ihn zu sich herunter. »Freilich«, wisperte sie in sein Ohr. »Freilich!«
Sie hatten noch ein wenig Zeit, aßen von den Melonen, die er mitgebracht hatte.
»Wie saftig sie sind, und wie süß!« Xandra wischte den klebrigen Saft von ihren Wangen. »Schade, dass wir in einigen Jahren keine mehr haben werden.«
Erst hatte Antoine gar nicht richtig hingehört, dann fragte er erstaunt: »Wie meinst du das?«
»Das Land trocknet aus, merkst du es nicht?« Xandra deutete zu Boden, schob einige Halme beiseite. »Das Grundwasser zieht sich in die Tiefe zurück.«
»Was kann man dagegen tun?«
»Ihr verbraucht zuviel Wasser. Und deshalb müsst ihr eure Brunnen immer tiefer graben.«
»Aber wir brauchen das Wasser«, rief Antoine. »Die Bevölkerung der Insel steigt, und Wasser braucht man zum Leben!«
»Ich habe dich gewarnt«, sagte Xandra. Dann sprachen sie nicht mehr darüber.
Als sie ein paar Minuten später, jeder in eine andere Richtung, aus dem Feld schlichen, war Antoine nicht mehr so guter Laune wie vorher. Xandra kam ihm ein wenig unheimlich vor.
Sie hatten diese Insel gewählt, weil sie für die Zustände auf der Erde repräsentativ war. Erst vor wenigen Jahren war sie von einem Segelschiff entdeckt und kurze Zeit darauf besiedelt worden. Es war gewissermaßen ein Neubeginn, und die Fremden konnten gut beobachten, wie sich die Menschen verhielten, welche Methoden sie anwandten, um sich von dem Land zu ernähren – und es zu erhalten. Versuchten sie überhaupt, es zu erhalten?
Außerdem hatte die Situation – das Auswandererschiff hatte bunt zusammengewürfelte Menschengruppen herangebracht – es dem Beobachter leichtgemacht, sich in die Gemeinschaft einzugliedern, ohne besondere Erklärungen für seine Abstammung geben zu müssen.
Emile und Xandra gingen Hand in Hand durch den Wald. Im leichten Sommerwind rauschten die Zweige über ihnen, und gelegentlich fielen einige gelbe Nadeln herab, blieben an ihren Kleidern hängen. Emile merkte nichts davon, denn er hatte nur Augen für Xandra. Sie war jetzt eine voll erblühte Frau, ihre dichten schwarzen Haare trug sie zu einem Zopf geflochten, der bei jedem Schritt leicht wippte.
»Wenn ich Bürgermeister bin«, sagte Emile, »werde ich tagsüber nicht mehr soviel Zeit haben. Es ist schön, mit dir spazieren zu gehen. Ich könnte immer weiter gehen mit dir, immer weiter...
»Es geht nicht mehr viel weiter«, sagte Xandra. »Dort vorn ist die Lichtung, und von dort sieht man bis zum Dorf. Du möchtest doch nicht mit mir gesehen werden.«
»Wir werden in den Nächten beisammen sein, in vielen langen Nächten«, flüsterte Emile, der sie nun an sich zog und lange küsste. Sie merkte es gern, wie sehr er sie bewunderte, wie sehr er von ihr abhängig war.
Ein paar Minuten später standen sie an der Lichtung, hier mussten sie sich trennen.
»Treffen wir uns noch einmal, solange die schönen Tage anhalten? Bist du einverstanden – übermorgen, hier, am Waldrand.«
»Das wird nicht möglich sein«, antwortete Xandra, auf einmal klang ihre Stimme ein wenig härter als sonst. »Dieses Stück Wald ist zum Abholzen freigegeben. Morgen kommen die Männer mit den Hacken und Sägen. Wir müssen uns woanders treffen.«
»Gut, dann woanders«, antwortete Emile leichthin.
»In zwei oder drei Jahren werden wir nicht mehr durch den Wald gehen können, denn es wird keinen Wald mehr geben. Die Bäume werden verschwunden sein, die Bäume und der Boden. Nackter Fels wird hier zutage treten, voll von Spalten und Schründen.«
»Was sagst du da«, fragte Emile erschreckt, »kannst du in die Zukunft sehen?«
»Man braucht kein Prophet zu sein«, antwortete Xandra. »Erst werden die Bäume abgeholzt, dann sterben die Wurzeln ab. Halten die Wurzeln das Erdreich nicht mehr zusammen, dann wird es vom Wasser fortgetragen. Die Bodenschichten sind nicht tief, schon nach ein oder zwei Metern beginnt eine Schicht aus Kalk. Geh hinüber ans Ufer, dann kannst du es sehen!«
Emile schwieg einige Zeit still. Er war bemüht, sich von dieser unangenehmen Vision zu befreien.
»Also übermorgen, dort drüben am Fels?« rief er Xandra betont fröhlich zu. Er winkte kurz und ging dann eilig fort.
Der Beobachter hatte den Auftrag, unerkannt zu bleiben, er durfte nicht auffallen. Das war ihm nicht so gelungen, wie er es sich gewünscht hatte: Obwohl er sich genauso benommen hatte, wie es die Männer erwarteten, geriet er mehr und mehr in die Isolation.
Dagegen war es ihm leichtgefallen, sein Äußeres nach dem Vorbild der Menschen zu gestalten. Obwohl sein Metabolismus ein völlig anderer war, beherrschte sein Volk doch die Mittel der Biotechnik mit hoher Perfektion. Nach und nach hatte er das Gewebe, mit dem er sich umkleidet hatte, so verändert, wie es den natürlichen Verschleißerscheinungen bei den Menschen entsprach.